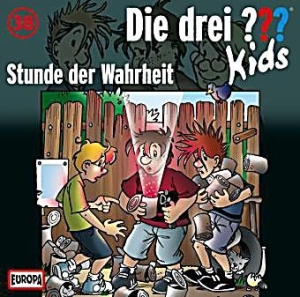Vor ein paar Tagen verbreitete sich ein Link zu einer Facebook-Seite durchs Netz. Diese Seite trug den Titel „Unread Stories“. Auf ihr können Facebook-Nutzer all jene Beiträge sehen, die Facebook ihnen vorenthalten hat. Es sind Beiträge, die zwar grundsätzlich in die Übersichtsseite – die Timeline – des jeweiligen Nutzers passen, weil sie von Facebook-Freunden kommen oder von Websites, die diese positiv bewertet haben. Doch der Algorithmus, der die Timeline zusammensetzt, hat diese Beiträge nicht berücksichtigt.
Dieser Link suggerierte, es sei möglich, die Maschine zu überlisten. Ich sehe was, was ich nicht sehen soll. Einen Moment lang hielt man ihn für die Lösung eines Problems. Bei genauerer Betrachtung stellte sich aber heraus: Dieser Link und die Gier nach ihm sind ein Teil des Problems.
![]()
Facebook und Twitter: angepasste Meinungen im Netz
Welches Problem? Das Netz, wie es heute existiert, verstärkt bestehende Meinungen. Es verhindert Kritik. Es fördert Konformismus, um nicht zu sagen: es fordert Konformismus. Dem zugrunde liegt ein uralter Effekt, der aus den allermeisten Gesellschaften bekannt ist. Menschen in Gruppen tendieren dazu, die herrschende Meinung zu bestätigen oder wenigstens nicht infrage zu stellen. In Verbindung mit der öffentlichen Meinung sprechen Forscher von der Schweigespirale. Drastischer sind Experimente, bei denen Menschen selbst dann objektiv falsche Aussagen machen, wenn sie die richtige Antwort kennen – nur, um denjenigen, die sich bereits vor ihnen falsch geäußert haben, nicht zu widersprechen.
Im Netz kann man dieses Phänomen beobachten wie nirgends sonst. Denn erstens sind es jetzt Maschinen, die den Menschen zur möglichst populären Meinung zwingen, und Maschinen sind nur schwer zu bekämpfen, weil sie lediglich Verhalten belohnen, sich aber selbst nicht überzeugen lassen. Sie wechseln nie die Seite, ihr Ausdauern endet erst, wenn jemand den Stecker zieht; den zieht aber niemand, solange die Maschine Geld verdient.
Zweitens umgeben uns diese Maschinen rund um die Uhr. Wer sich bei der Arbeit gerne im Namen der Konfliktvermeidung der Meinung seiner Kollegen anschließt, kann zu Hause immer noch eine andere Meinung vertreten. Facebook, Google und Twitter aber sind immer und überall. Und diese drei Systeme stehen nur stellvertretend für Mechanismen, die sich im ganzen Netz ausgebreitet haben.
Postet ein Nutzer im Netz einen Beitrag, zum Beispiel auf Facebook, sind die Reaktionen derjenigen Menschen, die diesen Beitrag sehen können, maßgeblich dafür, wie weit sich der Beitrag verbreitet. Und zwar nicht nur, weil die Reaktion selbst oft eine Weiterverbreitung darstellt, zum Beispiel, wenn ein Video von Dritten „geteilt“ wird. Sondern vor allem, weil Facebooks Algorithmus Beiträge sofort abstraft, die nur wenig Interesse hervorrufen. Das Programm, das über die Verbreitung von Inhalten bestimmt, registriert im Detail, wie beliebt Beiträge sind. Und Liebe, oder Zuneigung, ist das, was man auf Facebook am einfachsten loswird. „Like“ kann man klicken, „Dislike“ aber nicht.
Dabei steht Facebook hier nur exemplarisch für die vielen Ordnungsalgorithmen, die das digitale Angebot für die Nutzer zusammenstellen. Die Ergebnisse der Google-Suche sind auf ähnliche Art zusammengebaut, sie sind für jeden Nutzer individuell zurechtgeschnitten.
Ein Aha-Erlebnis der unangenehmen Art ist es, die Google-Suchergebnisse auf dem Rechner eines Freundes mit den eigenen zu vergleichen. Auch wenn man nach demselben Wort sucht, sind die Ergebnisse unterschiedlich. Der Algorithmus tut alles dafür, die Welt so zu formen, wie der Nutzer sie haben möchte. Oder haben soll. So bleibt jeder in seiner eigenen Filterbubble, in seiner eigenen Blase. Es gibt keinen Standard mehr, an dem man sich reiben könnte. Die digitale Welt kommt für jeden in einer maßgeschneiderten Form, Zutritt in die eigene Blase erhält – automatisiert – nur, wer nicht mit abweichenden Meinungen stört.
Das hat politische Implikationen bis hin zur Gefährdung der Demokratie. Meinungen verstärken sich: Wer konservativ ist, bekommt mehr Konservatismus. Und wer Facebook hasst, erhält mehr Kritik an Facebook. Denn die Zensur erfolgt nicht inhaltlich, sondern individuell. Das macht sie so perfide. Kritik an dem, was schon da ist, wird abgestraft. Duckmäusertum ist hier klüger als Widerspruch.
Das verändert die Debattenkultur. Es gilt das Mantra „Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, sag einfach gar nichts“. Die Regel stammt ursprünglich von einem Hasen aus dem Trickfilm „Bambi“. In der Nerdkultur ist sie zum geflügelten Wort geworden. In dieser Kultur entstehen die Systeme, die unser aller Leben bestimmen. Dabei muss „nett“ nicht im Wortsinne „nett“ sein. Üble Nachrede ist erlaubt, solange sie aufs zementierte Feindbild zielt. Wohin das führt, lässt sich in Washington beobachten, wo Republikaner und Demokraten immer wieder jede Kommunikation einstellen, bis der politische Prozess stagniert. Beim Bohren harter Bretter aber kommt man ohne Reibung nicht sehr weit.
Dabei ist die Langeweile, die derzeit noch durch die sich immer selbst bestätigenden Netze entsteht – und damit auch der Link auf die Facebook-Seite der verborgenen Einträge –, nur das kleinste Problem. Sie lässt den Nutzer merken, dass etwas nicht stimmt. Je smarter die Algorithmen werden, umso weniger langweilig wird uns allen sein. Eine kleine Dosis Widerspruch oder eine Pseudo-Kontroverse werden ausreichen, damit jeder zufrieden in seiner Blase lebt, weil niemand weiß, dass es eine Blase gibt.
Dabei versprach das Internet einst das Gegenteil: Nach der fiepsenden Einwahl mit dem Modem wartete eine wilde, aufregende Welt, eine kaum kontrollierte Anarchie voll kontroverser Meinungen auf schäbig entworfenen Webseiten. Jeder Klick eine Aufregung, jede Seite eine Überraschung. Das war, als Menschen über Inhalte herrschten und Austausch mit Freunden und Gegnern so wichtig war, wie Besucher auf die eigene Seite zu bekommen.
Diese Zustände gibt es immer noch. Aber sie sind nicht länger die Regel. Man muss nach ihnen suchen und sich aus eigenem Antrieb aus der Blase entfernen. Das gelingt vielen Menschen schon im realen Leben nur mit größter Mühe.
Zum dritten Oktober posierte Mark Zuckerberg in der Facebook-Zentrale mit einem Luftballon, der an die deutsche Einheit erinnerte. „Lasst uns weiterarbeiten, sodass eines Tages jeder mit jedem verbunden ist“, schreibt er im billigen Versuch, die deutsche Geschichte für sein Marketing zu missbrauchen. „Sodass es keine Mauern mehr gibt, die uns trennen.“ Heute müsste man ergänzen: und keine Meinungen mehr, die uns unterscheiden.
Dieser Link suggerierte, es sei möglich, die Maschine zu überlisten. Ich sehe was, was ich nicht sehen soll. Einen Moment lang hielt man ihn für die Lösung eines Problems. Bei genauerer Betrachtung stellte sich aber heraus: Dieser Link und die Gier nach ihm sind ein Teil des Problems.

Facebook und Twitter: angepasste Meinungen im Netz
Welches Problem? Das Netz, wie es heute existiert, verstärkt bestehende Meinungen. Es verhindert Kritik. Es fördert Konformismus, um nicht zu sagen: es fordert Konformismus. Dem zugrunde liegt ein uralter Effekt, der aus den allermeisten Gesellschaften bekannt ist. Menschen in Gruppen tendieren dazu, die herrschende Meinung zu bestätigen oder wenigstens nicht infrage zu stellen. In Verbindung mit der öffentlichen Meinung sprechen Forscher von der Schweigespirale. Drastischer sind Experimente, bei denen Menschen selbst dann objektiv falsche Aussagen machen, wenn sie die richtige Antwort kennen – nur, um denjenigen, die sich bereits vor ihnen falsch geäußert haben, nicht zu widersprechen.
Im Netz kann man dieses Phänomen beobachten wie nirgends sonst. Denn erstens sind es jetzt Maschinen, die den Menschen zur möglichst populären Meinung zwingen, und Maschinen sind nur schwer zu bekämpfen, weil sie lediglich Verhalten belohnen, sich aber selbst nicht überzeugen lassen. Sie wechseln nie die Seite, ihr Ausdauern endet erst, wenn jemand den Stecker zieht; den zieht aber niemand, solange die Maschine Geld verdient.
Zweitens umgeben uns diese Maschinen rund um die Uhr. Wer sich bei der Arbeit gerne im Namen der Konfliktvermeidung der Meinung seiner Kollegen anschließt, kann zu Hause immer noch eine andere Meinung vertreten. Facebook, Google und Twitter aber sind immer und überall. Und diese drei Systeme stehen nur stellvertretend für Mechanismen, die sich im ganzen Netz ausgebreitet haben.
Postet ein Nutzer im Netz einen Beitrag, zum Beispiel auf Facebook, sind die Reaktionen derjenigen Menschen, die diesen Beitrag sehen können, maßgeblich dafür, wie weit sich der Beitrag verbreitet. Und zwar nicht nur, weil die Reaktion selbst oft eine Weiterverbreitung darstellt, zum Beispiel, wenn ein Video von Dritten „geteilt“ wird. Sondern vor allem, weil Facebooks Algorithmus Beiträge sofort abstraft, die nur wenig Interesse hervorrufen. Das Programm, das über die Verbreitung von Inhalten bestimmt, registriert im Detail, wie beliebt Beiträge sind. Und Liebe, oder Zuneigung, ist das, was man auf Facebook am einfachsten loswird. „Like“ kann man klicken, „Dislike“ aber nicht.
Dabei steht Facebook hier nur exemplarisch für die vielen Ordnungsalgorithmen, die das digitale Angebot für die Nutzer zusammenstellen. Die Ergebnisse der Google-Suche sind auf ähnliche Art zusammengebaut, sie sind für jeden Nutzer individuell zurechtgeschnitten.
Ein Aha-Erlebnis der unangenehmen Art ist es, die Google-Suchergebnisse auf dem Rechner eines Freundes mit den eigenen zu vergleichen. Auch wenn man nach demselben Wort sucht, sind die Ergebnisse unterschiedlich. Der Algorithmus tut alles dafür, die Welt so zu formen, wie der Nutzer sie haben möchte. Oder haben soll. So bleibt jeder in seiner eigenen Filterbubble, in seiner eigenen Blase. Es gibt keinen Standard mehr, an dem man sich reiben könnte. Die digitale Welt kommt für jeden in einer maßgeschneiderten Form, Zutritt in die eigene Blase erhält – automatisiert – nur, wer nicht mit abweichenden Meinungen stört.
Das hat politische Implikationen bis hin zur Gefährdung der Demokratie. Meinungen verstärken sich: Wer konservativ ist, bekommt mehr Konservatismus. Und wer Facebook hasst, erhält mehr Kritik an Facebook. Denn die Zensur erfolgt nicht inhaltlich, sondern individuell. Das macht sie so perfide. Kritik an dem, was schon da ist, wird abgestraft. Duckmäusertum ist hier klüger als Widerspruch.
Das verändert die Debattenkultur. Es gilt das Mantra „Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, sag einfach gar nichts“. Die Regel stammt ursprünglich von einem Hasen aus dem Trickfilm „Bambi“. In der Nerdkultur ist sie zum geflügelten Wort geworden. In dieser Kultur entstehen die Systeme, die unser aller Leben bestimmen. Dabei muss „nett“ nicht im Wortsinne „nett“ sein. Üble Nachrede ist erlaubt, solange sie aufs zementierte Feindbild zielt. Wohin das führt, lässt sich in Washington beobachten, wo Republikaner und Demokraten immer wieder jede Kommunikation einstellen, bis der politische Prozess stagniert. Beim Bohren harter Bretter aber kommt man ohne Reibung nicht sehr weit.
Dabei ist die Langeweile, die derzeit noch durch die sich immer selbst bestätigenden Netze entsteht – und damit auch der Link auf die Facebook-Seite der verborgenen Einträge –, nur das kleinste Problem. Sie lässt den Nutzer merken, dass etwas nicht stimmt. Je smarter die Algorithmen werden, umso weniger langweilig wird uns allen sein. Eine kleine Dosis Widerspruch oder eine Pseudo-Kontroverse werden ausreichen, damit jeder zufrieden in seiner Blase lebt, weil niemand weiß, dass es eine Blase gibt.
Dabei versprach das Internet einst das Gegenteil: Nach der fiepsenden Einwahl mit dem Modem wartete eine wilde, aufregende Welt, eine kaum kontrollierte Anarchie voll kontroverser Meinungen auf schäbig entworfenen Webseiten. Jeder Klick eine Aufregung, jede Seite eine Überraschung. Das war, als Menschen über Inhalte herrschten und Austausch mit Freunden und Gegnern so wichtig war, wie Besucher auf die eigene Seite zu bekommen.
Diese Zustände gibt es immer noch. Aber sie sind nicht länger die Regel. Man muss nach ihnen suchen und sich aus eigenem Antrieb aus der Blase entfernen. Das gelingt vielen Menschen schon im realen Leben nur mit größter Mühe.
Zum dritten Oktober posierte Mark Zuckerberg in der Facebook-Zentrale mit einem Luftballon, der an die deutsche Einheit erinnerte. „Lasst uns weiterarbeiten, sodass eines Tages jeder mit jedem verbunden ist“, schreibt er im billigen Versuch, die deutsche Geschichte für sein Marketing zu missbrauchen. „Sodass es keine Mauern mehr gibt, die uns trennen.“ Heute müsste man ergänzen: und keine Meinungen mehr, die uns unterscheiden.