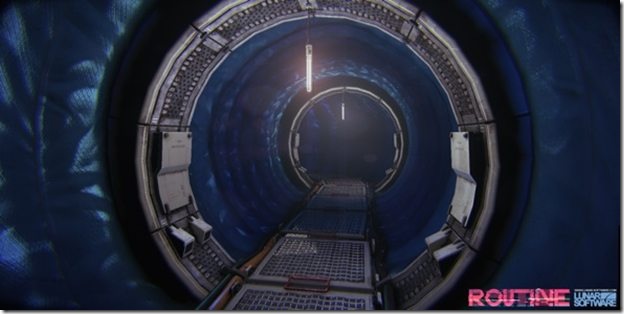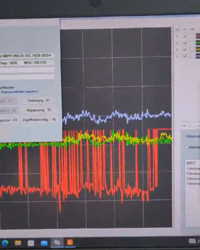Ich weiß nicht mehr, wie das Schullandheim hieß. Aber ich erinnere mich noch genau an den Geruch: Bohnerwachs, drückender Sommer, klinisch lackierter Pressspan, Küchendunst in schweren Vorhängen. Ich sehe noch den seltsam farblosen Linoleumboden vor mir und die rosa-braun-pastellfarbenen Wände im Gang zum Speisesaal. Und ich weiß noch, wie ein Klassenkamerad dort auf mich zukam – irritiert, besorgt, verwirrt – und fragte, was denn los sei, als erst mein Kinn anfing zu zittern, die Augen sich dann zu Schlitzen verengten, kämpften und schließlich doch Tränen freigaben. Ich stand einfach da. Machtlos, gelähmt, schluchzend. Schon seit Minuten hatte ich gespürt, wie das Gefühl meine Brust langsam ausfüllte. Wie es in die Arme und Beine wanderte, in den Hals, in den Kopf, bis zu den Haarspitzen.
![]()
Thomas Mann kannte ich da noch nicht. Dabei hat er in seiner Erzählung „Tonio Kröger“ wunderbar beschrieben, was mich damals peinigte: „Und plötzlich erschütterte das Heimweh seine Brust mit einem solchen Schmerz, dass er unwillkürlich weiter ins Dunkel zurückwich, damit niemand das Zucken seines Gesichtes sähe.“ Damals, in der fünften Klasse, war da nirgends ein Dunkel. Keine Rückzugsmöglichkeit. Also log ich, sagte etwas von plötzlichen Kopfschmerzen. Auch am zweiten Tag. Am dritten wechselte ich zu schwerer Übelkeit. Dann holten mich meine Eltern ab.
Es gibt bessere Starts ins erste Jahr auf dem Gymnasium. Heimweh war schon damals verlacht. Heimweh, das hatten Muttersöhnchen.
Heute ist Heimweh tot. Das Wort klingt aus der Zeit gefallen wie „Zugehfrau“ oder „Tanzkarte“. Vorabendserien haben es besetzt, Heimatfilme und Vertriebenenverbände. Abseits davon fordert unsere Gesellschaft den Verzicht auf Heimweh. Mobilität ist gefragt: Auslandssemester, Auslandspraktika, Sprachkenntnisse, Lebenslauf. Später für den Job Stadt, Land oder Kontinent wechseln. Und überall vom Fleck weg funktionieren. Nicht nur allzeit bereit sei der Mensch, sondern auch allzeit und allüberall zu Hause. Ein sozialer Druck, den wir auch beim Bier mit den Kumpels längst spüren: Wer nie im Ausland war oder es wenigstens für höchst erstrebenswert hält, dort einmal hinzugehen, gilt schnell als Stubenhocker. Ist wieder das Muttersöhnchen aus dem Schullandheim. In einer globalisierten Welt, in der jeder jeden jederzeit wenigstens auf Computer- oder Smartphone-Bildschirmen sehen kann, ist dem Heimweh doch die Grundlage entzogen. Pah!
München im Mai vergangenen Jahres: Die Pressekonferenz ist beinahe vorbei. Aber einen wichtigen Punkt hat Johan Simons noch auf der Agenda: seine Zukunft. Der Mann ist ein geübter Redner, hier liest er jedoch lieber von einem Zettel ab. Er werde seinen Vertrag als Intendant der Münchner Kammerspiele nicht über die Spielzeit 2014/15 hinaus verlängern, erklärt der Niederländer. „Danach muss ich wieder nach Hause.“ Simons hat Erfolg in seinem Job, und er liebt, was er tut. Aber er hat Heimweh: Er komme jeden Abend in seine Wohnung, ohne seine Frau, seine Kinder dort anzutreffen – und „das Leben ist endlich“.
Heimweh muss längst nicht nur die Sehnsucht nach einem Ort sein. Dafür hat sich unser Verständnis von Heimat viel zu sehr gewandelt. Es geht schlicht um Vertrautes. Und das wird es immer geben. Wer den Schmerz also für ein bloßes Relikt hält, der unterschätzt seine archaische Kraft. Und seine Zeitlosigkeit. Der hat wohl auch noch niemals erlebt, wie der Schmerz Farbe und Kontraste aus der Umgebung saugt. Die Leichtigkeit. Und auch die Freude. Nur Liebeskummer ist ähnlich schlimm und zeitlos. Weil beides Verlust betrauert.Christopher Thurber, Psychologe an der Bostoner Phillips Exeter Academy, ist Heimwehforscher. Einer von sehr wenigen. Er schätzt, dass jeder fünfte Schüler an Internaten und Universitäten in den USA mit starkem Heimweh kämpft. Bei ihnen sei etwa das Risiko, dass sie die Ausbildung abbrechen, dreimal höher. Forscher in Deutschland vermuten bei Migranten eine höhere Anfälligkeit für Depressionen und psychosomatische Erkrankungen. Das ist das allerdings empirisch noch nicht ausreichend belegt.
Wer über den Komplex spricht, spekuliert. Er ist immer noch wenig erforscht. Und wo er in der Forschung einmal auftauchte, wurde es schnell abenteuerlich: Für den Elsässer Mediziner Johannes Hofer, der den Begriff in seiner Dissertation 1688 erstmals ausbuchstabierte, handelte es sich noch um eine Krankheit mit potenziell tödlichem Ausgang. Die „Schweizer Krankheit“ soll damals vor allem helvetische Söldner befallen haben. In Frankreich, wo die Mietsoldaten unter anderem kämpften, war es deshalb bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts unter Todesstrafe verboten, den „Kuhreihen“, ein bekanntes Hirtenlied, zu singen oder auch nur zu pfeifen. Die Söldner seien, von der Melodie ergriffen, reihenweise desertiert. Ende des 18. Jahrhunderts häuften sich Fälle, in denen Dienstmädchen Häuser niedergebrannt und Kinder getötet haben sollen, um heimzudürfen. Die Gerichte sollen milde geurteilt haben. Danach geriet das Heimweh als Krankheit in Vergessenheit.
Aber als Gefühl tauchte es immer wieder auf. In Schüben, getarnt als Glaube an eine angeblich bessere Vergangenheit. Als Nostalgie. Als Ostalgie. Als Zeitgeist. Wer es finden will, muss ihm nachspüren, in der Kunst zum Beispiel. Oder in der Unterhaltung. Freddy Quinns „Heimweh“ war der meistverkaufte Song der 1950er-Jahre. Weitere seiner Hits: „Heimatlos“, „Unter fremden Sternen“, „Weit ist der Weg“, „Junge, komm bald wieder“. Alle Nummer eins oder zumindest Millionenverkäufe, begründet auf eine diffuse kollektive Sehnsucht im Nachkriegsdeutschland. In den Achtzigern war es „E.T.“. Steven Spielbergs Film über einen gestrandeten Außerirdischen, der – „nach Hause telefonieren“ – vor Trauer beinahe eingeht, spielte weltweit etwa 800 Millionen Dollar ein.
Ob Skype E.T. geholfen hätte? Oder ein Facebok-Account? Heimwehforscher Thurber bezweifelt das. Natürlich simuliere ein Gespräch, bei dem man sich am Bildschirm sieht, Nähe. Aber es ersetze sie nicht. Tägliches Skypen könne sogar verhindern, dass man in der neuen Welt ankommt. Das neue Leben lebt. Kontakte knüpft. Soziale Medien wären in dieser Lesart der „Kuhreihen“ 2014. Nur ohne Todesstrafe.

Thomas Mann kannte ich da noch nicht. Dabei hat er in seiner Erzählung „Tonio Kröger“ wunderbar beschrieben, was mich damals peinigte: „Und plötzlich erschütterte das Heimweh seine Brust mit einem solchen Schmerz, dass er unwillkürlich weiter ins Dunkel zurückwich, damit niemand das Zucken seines Gesichtes sähe.“ Damals, in der fünften Klasse, war da nirgends ein Dunkel. Keine Rückzugsmöglichkeit. Also log ich, sagte etwas von plötzlichen Kopfschmerzen. Auch am zweiten Tag. Am dritten wechselte ich zu schwerer Übelkeit. Dann holten mich meine Eltern ab.
Es gibt bessere Starts ins erste Jahr auf dem Gymnasium. Heimweh war schon damals verlacht. Heimweh, das hatten Muttersöhnchen.
Heute ist Heimweh tot. Das Wort klingt aus der Zeit gefallen wie „Zugehfrau“ oder „Tanzkarte“. Vorabendserien haben es besetzt, Heimatfilme und Vertriebenenverbände. Abseits davon fordert unsere Gesellschaft den Verzicht auf Heimweh. Mobilität ist gefragt: Auslandssemester, Auslandspraktika, Sprachkenntnisse, Lebenslauf. Später für den Job Stadt, Land oder Kontinent wechseln. Und überall vom Fleck weg funktionieren. Nicht nur allzeit bereit sei der Mensch, sondern auch allzeit und allüberall zu Hause. Ein sozialer Druck, den wir auch beim Bier mit den Kumpels längst spüren: Wer nie im Ausland war oder es wenigstens für höchst erstrebenswert hält, dort einmal hinzugehen, gilt schnell als Stubenhocker. Ist wieder das Muttersöhnchen aus dem Schullandheim. In einer globalisierten Welt, in der jeder jeden jederzeit wenigstens auf Computer- oder Smartphone-Bildschirmen sehen kann, ist dem Heimweh doch die Grundlage entzogen. Pah!
München im Mai vergangenen Jahres: Die Pressekonferenz ist beinahe vorbei. Aber einen wichtigen Punkt hat Johan Simons noch auf der Agenda: seine Zukunft. Der Mann ist ein geübter Redner, hier liest er jedoch lieber von einem Zettel ab. Er werde seinen Vertrag als Intendant der Münchner Kammerspiele nicht über die Spielzeit 2014/15 hinaus verlängern, erklärt der Niederländer. „Danach muss ich wieder nach Hause.“ Simons hat Erfolg in seinem Job, und er liebt, was er tut. Aber er hat Heimweh: Er komme jeden Abend in seine Wohnung, ohne seine Frau, seine Kinder dort anzutreffen – und „das Leben ist endlich“.
Nur Liebeskummer ist ähnlich schlimm und zeitlos.
Heimweh muss längst nicht nur die Sehnsucht nach einem Ort sein. Dafür hat sich unser Verständnis von Heimat viel zu sehr gewandelt. Es geht schlicht um Vertrautes. Und das wird es immer geben. Wer den Schmerz also für ein bloßes Relikt hält, der unterschätzt seine archaische Kraft. Und seine Zeitlosigkeit. Der hat wohl auch noch niemals erlebt, wie der Schmerz Farbe und Kontraste aus der Umgebung saugt. Die Leichtigkeit. Und auch die Freude. Nur Liebeskummer ist ähnlich schlimm und zeitlos. Weil beides Verlust betrauert.Christopher Thurber, Psychologe an der Bostoner Phillips Exeter Academy, ist Heimwehforscher. Einer von sehr wenigen. Er schätzt, dass jeder fünfte Schüler an Internaten und Universitäten in den USA mit starkem Heimweh kämpft. Bei ihnen sei etwa das Risiko, dass sie die Ausbildung abbrechen, dreimal höher. Forscher in Deutschland vermuten bei Migranten eine höhere Anfälligkeit für Depressionen und psychosomatische Erkrankungen. Das ist das allerdings empirisch noch nicht ausreichend belegt.
Wer über den Komplex spricht, spekuliert. Er ist immer noch wenig erforscht. Und wo er in der Forschung einmal auftauchte, wurde es schnell abenteuerlich: Für den Elsässer Mediziner Johannes Hofer, der den Begriff in seiner Dissertation 1688 erstmals ausbuchstabierte, handelte es sich noch um eine Krankheit mit potenziell tödlichem Ausgang. Die „Schweizer Krankheit“ soll damals vor allem helvetische Söldner befallen haben. In Frankreich, wo die Mietsoldaten unter anderem kämpften, war es deshalb bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts unter Todesstrafe verboten, den „Kuhreihen“, ein bekanntes Hirtenlied, zu singen oder auch nur zu pfeifen. Die Söldner seien, von der Melodie ergriffen, reihenweise desertiert. Ende des 18. Jahrhunderts häuften sich Fälle, in denen Dienstmädchen Häuser niedergebrannt und Kinder getötet haben sollen, um heimzudürfen. Die Gerichte sollen milde geurteilt haben. Danach geriet das Heimweh als Krankheit in Vergessenheit.
Aber als Gefühl tauchte es immer wieder auf. In Schüben, getarnt als Glaube an eine angeblich bessere Vergangenheit. Als Nostalgie. Als Ostalgie. Als Zeitgeist. Wer es finden will, muss ihm nachspüren, in der Kunst zum Beispiel. Oder in der Unterhaltung. Freddy Quinns „Heimweh“ war der meistverkaufte Song der 1950er-Jahre. Weitere seiner Hits: „Heimatlos“, „Unter fremden Sternen“, „Weit ist der Weg“, „Junge, komm bald wieder“. Alle Nummer eins oder zumindest Millionenverkäufe, begründet auf eine diffuse kollektive Sehnsucht im Nachkriegsdeutschland. In den Achtzigern war es „E.T.“. Steven Spielbergs Film über einen gestrandeten Außerirdischen, der – „nach Hause telefonieren“ – vor Trauer beinahe eingeht, spielte weltweit etwa 800 Millionen Dollar ein.
Ob Skype E.T. geholfen hätte? Oder ein Facebok-Account? Heimwehforscher Thurber bezweifelt das. Natürlich simuliere ein Gespräch, bei dem man sich am Bildschirm sieht, Nähe. Aber es ersetze sie nicht. Tägliches Skypen könne sogar verhindern, dass man in der neuen Welt ankommt. Das neue Leben lebt. Kontakte knüpft. Soziale Medien wären in dieser Lesart der „Kuhreihen“ 2014. Nur ohne Todesstrafe.